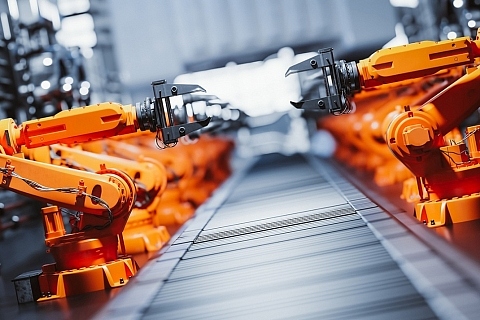1. Einführung: Ethik der Nähe im Zeitalter der Distanz
In kaum einer Epoche war das Thema “Führung” so stark moralisch aufgeladen wie heute. Künstliche Intelligenz, volatile Märkte und hybride Arbeitsformen verändern nicht nur Strukturen, sondern auch das Menschenbild in Organisationen. Führungskräfte sehen sich konfrontiert mit wachsender Unsicherheit, Komplexität und Entfremdung. In dieser Lage erscheint Burkhard Hankes Buch “Knallhart empathisch. Führen mit Herz und Hirn – Der Schlüssel zu Vertrauen, Motivation und Erfolg” (Goldegg Verlag, 2025) als Versuch, das Menschliche in der Führung stark zu machen. Liebend führen, so kann man die These zusammenfassen, die Hankes Buch entfaltet, vermag gerade heute Führungskräfte zu orientieren: praktisch und theoretisch, moralisch und ethisch.
Der Untertitel signalisiert bereits, wo der Autor ansetzt. Es geht nicht um einen weiteren Ratgeber für “Soft Skills”, sondern um eine Rückbesinnung auf eine Ethik der Beziehung. Hanke, selbst erfahrener Manager, Coach und Personalentwickler, hat drei Jahrzehnte Führungsverantwortung in internationalen Unternehmen hinter sich. Seine zentrale These: Empathie ist kein Widerspruch zur Konsequenz, sondern ihre Bedingung. Damit nimmt Hanke ein Thema auf, das im Forum Wirtschaftsethik seit Jahren diskutiert wird: Wie kann Führung ethisch verantwortbar bleiben, wenn Strukturen von Beschleunigung, Kontrolle und Effizienzdruck geprägt sind? Sein Buch ist ein Appell, Haltung und System wieder in Einklang zu bringen.
2. Knallhart empathisch – ein programmatischer Titel?
Der Titel wirkt auf den ersten Blick paradox – und genau das ist gewollt. “Knallhart” steht für Klarheit, Mut, Konsequenz. “Empathisch” für Verständnis, Beziehung, Mitgefühl. Hanke kombiniert beides zu einem neuen Leitbild: einer Führung mit Rückgrat und Resonanz. Der Darstellungsstil des Buches wird polarisieren, er ist auch nicht einheitlich. Titel, Zwischentitel und Verlags- (oder Eigenwerbung?) wirken fast reißerisch, nach dem Motto: (Buch-) Erfolg um jeden Preis. Aber dann folgen glänzend geschriebene Kapitel: Eine einprägsame literarische Szene, kurze Zusammenfassungen einschlägiger Studien (die zeigen, wie teuer es werden kann, “knallhart” unempathisch zu führen, ein wieder einprägsames Beispiel aus eigener Führungserfahrung, die Benennung exemplarischer Umsetzungsthemen und schließlich folgen Umsetzungsappelle: Ändere dein persönliches Führungsverhalten – und ändere die Strukturen, in denen du führst, auch wenn das riskant ist: um Angst abzubauen, Schwache stark zu machen, Potenziale zu fördern.
Hanke schreibt nicht als Theoretiker, sondern als Praktiker, der weiß, wie es sich anfühlt, zwischen Leistungsdruck, Zielvereinbarungen und menschlicher Verantwortung zu stehen. Er beschreibt sich selbst als jemanden, der Burnout und Erschöpfung erlebt hat – und daraus gelernt hat, dass Stärke ohne Empathie in Isolation führt.
“Führung funktioniert nur mit Liebe. Das reicht.” (S. 187)
Dieser Satz steht am Ende des Buches – und zugleich im Zentrum seines Ethos. Er markiert die Bewegung, die Hanke vollzieht: von der Leistungsorientierung zur Liebesorientierung, von Kontrolle zu Vertrauen, von Management zu Beziehung.
3. Zwischen Psychologie und Ethik: Der Einfluss von Gerald Hüther
Hankes Denken ist stark von der Neurobiologie Gerald Hüthers beeinflusst. Dessen These, dass menschliche Entwicklung auf Bindung, Vertrauen und Ermutigung basiert, ist bei Hanke an vielen Stellen spürbar. Er zitiert Hüthers Definition von Liebe als “unbedingtem Interesse an der Entwicklung des anderen” und erhebt sie zum Kern seiner Führungsphilosophie.
Damit wird Hüther zum wissenschaftlich-ethischen Resonanzraum des Buches. Hanke nutzt neurobiologische Erkenntnisse als moralische Argumente: Empathie ist nicht nur “nett”, sie ist neurobiologisch notwendig. Führung, die auf Angst oder Kontrolle basiert, blockiert Lernfähigkeit, Kreativität und Sinn. Führung, die Vertrauen schafft, aktiviert hingegen neuronale Systeme für Motivation und Kooperation.
Hanke übersetzt also Hüthers Anthropologie in eine Führungsethik: Aus “Potentialentfaltung” wird “Entwicklungsverantwortung”, aus “Bindungssicherheit” wird “Vertrauensführung”, aus “Ermutigung” wird “Resonanzkultur”. Man könnte sagen: Hanke ist Hüther mit Haltung – er moralisiert die Neurobiologie.
4. Empathie als moralische Kompetenz
Hankes zentrales Umsetzungsargument lautet dabei: Empathie ist eine moralische Kompetenz, keine emotionale Mode. Sie ist die Fähigkeit, die Realität des anderen wahrzunehmen, ohne die eigene Klarheit zu verlieren. Empathie ist also nicht “weich”, sondern eine Form kognitiver und ethischer Stärke.
Damit nähert sich Hanke einer Verantwortungsethik im Sinne von Hans Jonas an: Der empathisch Führende nimmt Verantwortung auf sich, weil er die Wirkung seines Handelns auf andere mitdenkt. Hanke schreibt: “Empathie ist nicht das Gegenteil von Strenge. Sie ist ihre Bedingung.” (S. 185)
Diese Formulierung enthält eine präzise Umkehrung des gängigen Denkens: Nicht das Durchsetzen ist der Beweis von Stärke, sondern das Verstehen bei gleichzeitiger Klarheit. Hier berührt sich Hanke mit Ansätzen der relationalen Ethik – etwa bei Martin Buber oder Carol Gilligan. Führung, verstanden als Beziehung, ist ein ethischer Akt.
5. Zwischen Haltung und System: Das strukturelle Defizit
So überzeugend Hankes Anthropologie ist und wie sehr seine Beispiele und Appelle auch berühren: spätestens bei Umsetzungsversuchen zeigen sich Leerstellen, oder anders: das starke Buch hat auch seine Schwächen: Was passiert, wenn die Organisation selbst empathiefeindlich ist? Wie führe ich “knallhart empathisch”, wenn Ziele, Vorgaben und Anreizsysteme das Gegenteil belohnen? Wie bleibe ich integer, wenn Integrität ein Karriererisiko bedeutet?
Diese Fragen stellt Hanke nur implizit. Er setzt auf individuelle Haltung – Selbstführung, Mut, Präsenz -, aber er liefert kein Navigationsmodell für strukturelle Dilemmata. Dabei verschärfen sich für Führungskräfte gerade diese Konfliktsituationen. Hier bleibt Hanke leise. Verkürzt formuliert: Er benennt Macht, aber er analysiert sie nicht. Er schreibt über Verantwortung, aber nicht über Risiko. Er inspiriert – aber er rüstet nicht.
Man müsste Führungskräfte sogar auf zusätzliche Risiken hinweisen, wenn sie Hankes (und Hüthers) Ansatz folgen: Wie gehen sie damit um, dass gerade unsichere Mitarbeitende oft starke Führung erwarten, dass sie bei Besprechungen wissen wollen, wo der sitzt, der die Ansagen macht, dass sie leiden, wenn solche Vorgaben sich immer wieder ändern? Wie schütze ich mein System (und mich selbst) davor, dass meine “knallharte Empathie” als Führungskraft nur meinen Narzissmus überdeckt: Ich führe alternativ und vorwärtsweisend – und wenn ich dann in einer Organisation, in der das gerade passt, belohnt und wegbefördert werde: dann brechen hinter mir die Strukturen zusammen und verschleppte Personalentscheidungen folgen abrupt.
6. Empathie im Zeitalter der Unsicherheit
Dies allerdings ist der Punkt, an dem sich eine Weiterarbeit mit Hankes Ansatz anbietet. Zwar: Eine Empathie-Ethik ohne Machtanalyse bleibt auf halbem Weg stehen. Die Zukunft verantwortlicher Führung braucht beides: die Haltung des Einzelnen und die Gestaltung der Strukturen, die sie ermöglichen. Hankes Buch erscheint in einer Zeit, in der sich Führung radikal verändert. Künstliche Intelligenz automatisiert Entscheidungen, Hierarchien lösen sich auf, Arbeitsbeziehungen werden flüchtiger. Und vor allem: das Umfeld, sogar die Umwelt der Organisation ändern sich so schnell, dass persönliche und strukturelle Herausforderungen gerade im Aufgabenbereich Führung zunehmen – so dass hier tatsächlich wieder einmal neu gedacht und anders gehandelt werden muss. Das “Neue Normal” ist nicht Stabilität, sondern Unsicherheit: die permanente Krise.
Aber das sind alles Binsensweisheiten. Gerade in dieser Lage ist Hanke hochrelevant, weil sein Buch neu zu orientieren vermag, wenn man sich von ihm inspirieren lässt: In mehrfacher Hinsicht: Es erinnert daran, dass Empathie keine Schwäche ist, sondern zur Überlebensstrategie werden kann. Führung im digitalen Zeitalter braucht Vertrauen, weil Kontrolle in Komplexität versagt. Sein Konzept mag an einigen Stellen psychologisch bleiben, wo organisations- oder sogar strukturpolitische Entscheidungen anstehen. Aber genau hier liegt dann seine kulturelle Kraft: “Knallhart empathisch” ist weniger Handlungsanleitung als Gegenkultur – eine Einladung, Menschlichkeit als Organisationswert wiederzuentdecken.
7. Zwischen Religion und säkularer Spiritualität: ein biografisches Schlusswort
Ich darf beim Fazit biografisch ansetzen. Burkhard Hanke kenne ich als Sozialethiker aus seinen theologischen Studienjahren. Damals haben wir bereits gemeinsam daran gearbeitet, theologische Ethik als Wirtschafts- und Unternehmensethik praktisch werden zu lassen: Alles andere schien uns eine Flucht auch aus der wissenschaftlichen Verantwortung zu sein. Die dann konsequente Gründung eines Instituts für Wirtschafts- und Sozialethik (IWS) in Kiel (und Rostock, direkt nach der Wende!) hat uns beide zu Gründungsmitgliedern des DNWE werden lassen.
Schon damals hat uns bei der Umsetzung der ja nur scheinbar paradoxe Ansatz des dienenden Führens begeistert (Servant leadership, Robert K. Greenleaf). Ich integriere ihn bis heute in einer kreativitätstheoretischen (schöpfungstheologischen) Metatheorie. Was Hanke heute in säkularer Sprache als “Empathie” beschreibt, konkretisierte sich uns damals in Umsetzungs- und Beratungskonzepten als Haltung des diakonischen Führens: Stärke, die sich im Dienen verwirklicht.
Im letzten Kapitel öffnet Hanke einen existenziellen Horizont. Mehrfach spricht er von Liebe als Haltung, von Präsenz, von Ganzheit. “Es gibt eine Haltung, die nicht erklärt, sondern erinnert. Eine Haltung, die nicht angewendet, sondern gelebt wird. Diese Haltung ist Liebe.” (S. 187) Solche Sätze haben fast liturgischen Klang. Sie übersetzen religiöse Motive – Liebe, Demut, Verantwortung – in säkulare Führungsethik. Man könnte von einer säkularen Caritas sprechen: einer Ethik der tätigen Liebe im Organisationsalltag.
Theologisch betrachtet entspricht das einer “agapischen” Ethik (diesen Ausdruck schlägt KI vor). Liebe als Entscheidung, nicht als Gefühl. Hanke säkularisiert die christliche Nächstenliebe und macht sie zur Führungsnorm. Seine Sprache bleibt offen genug, um auch spirituell Suchende anzusprechen, die Religion hinter sich gelassen haben, aber Sinn und Haltung suchen. Gerade diese biografische Offenheit macht das Buch glaubwürdig – aber auch verletzlich. Man spürt, dass es aus Erfahrung, nicht aus Theorie entstanden ist. Doch genau das birgt eine Gefahr: Die Sprache des Heilens könnte zur Sprache des Marketings werden.
“Knallhart empathisch” ist ein eindrucksvolles Buch über die Wiederentdeckung des Menschlichen in der Führung. Hier berührt sich Hankes Ansatz mit einer alten paulinischen und lutherischen Einsicht: Liebe macht frei – und entfaltet Veränderungspotenziale. Doch sobald Liebe nicht als Geschenk angenommen, sondern zur Forderung wird, wird sie zum „Gesetz, das tötet”. Darum braucht die Empathie strukturelle Rückendeckung. Sie ist eine Sekundärtugend, der Liebe Gesicht und Gestalt gibt. Auch für Strukturentwicklung muss Führungsverantwortung übernommen werden. Burkhard Hankes Buch liest sich leicht. Es inspiriert und orientiert. Man sollte es als Führungskraft gerade heute lesen.
Literaturangabe
Burkhard Hanke: Knallhart empathisch. Führen mit Herz und Hirn – Der Schlüssel zu Vertrauen, Motivation und Erfolg. Goldegg Verlag, Wien 2025. 224 S., ISBN 978-3-99060-535-1.
Über Wolfgang Nethöfel

Wolfgang Nethöfel (geb. 1946) lehrte nach einem Studium der Theologie, Philosophie, Literatur- und Sprachwissenschaft Sozialethik in Marburg. In Innovations-, Beratungs- und Schulungsprojekten arbeitet er auch als Gestalttherapeut und Mediator. Er lebt in Frankfurt und ist dort engagiert präsent in der Evangelischen Hoffnungsgemeinde, in der „Werkstatt Bahnhofsviertel“ – und als Autor. Sein Lebensthema ist Orientierung im Epochenwechsel.
Zuletzt veröffentlicht:
Innovation (3.Aufl.)
Regulierung
Tiefe Innovation
Eunet. Ein App-Roman
(Zwischen Kreativität und Schöpfung I-IV)
Alle: Göttingen: Cuveillier Verlag 2025
https://cuvillier.de/de/shop/people/65075-wolfgang-nethofel
Über Burkhard Hanke

Burkhard Hanke (geb. 1963) ist evangelischer Theologe, Leadership-Experte und Mitgründer des Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik (DNWE). Mit über 30 Jahren internationaler Erfahrung in HR, Leadership und Nachhaltigkeitsmanagement verbindet er ökonomische Perspektiven mit ethischer Verantwortung. Sein Motto: Zuversicht ist die beste Sicht.
HINWEIS:
Bitte beachten Sie auch:
Burkhard Hankes Beitrag
Rezension zu Wolfgang Nethöfels Tetralogie: Zwischen Kreativität und Schöpfung I-III & EUNET