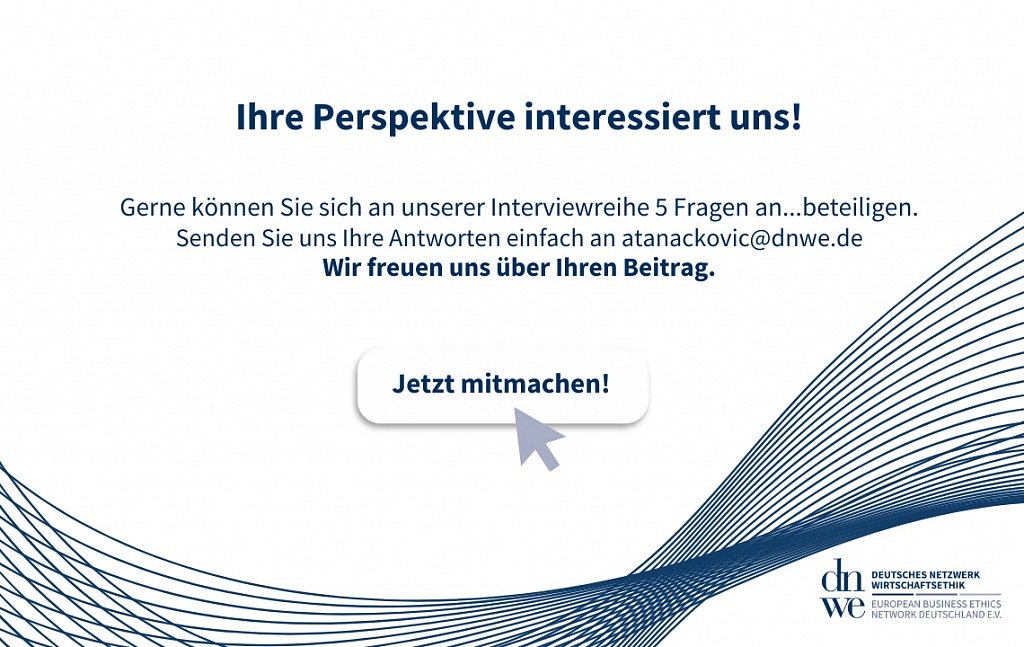Die Debatte um die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen – kurz CSR – ist nicht neu, befindet sich jedoch seit geraumer Zeit im Wandel. Der Ukraine-Krieg hat eine Frage in den Fokus gerückt, die auch außerhalb dieses Konfliktes relevant ist: Wie verhalten sich Unternehmen in Kriegszeiten? Und aus wirtschaftsethischer Sicht vor allem die Frage: Wie sollen oder sollten sich Unternehmen in politischen Fragen verhalten? Kurz: Wie beschreiben wir die Corporate Political Responsibility? Zu diesem Thema haben wir 5 Fragen an … Valentine Baumert.
(1) Wo beginnt für Sie “politisches Engagement von Unternehmen” und an welche Beispiele denken Sie?
Valentine Baumert: Politisches Engagement von Unternehmen beginnt genau genommen schon im Kleinen: Im Internen, bei dem Arbeitsumfeld, das für Mitarbeitende geschaffen wird, bei den Strukturen, Hierarchien und der allgemeinen Kultur des Unternehmens. Bereits diese können mehr oder weniger demokratisch organisiert sein, Gleichberechtigung fördern oder eben auch verhindern. Nicht zuletzt ist auch die Zusammensetzung der Mitarbeitenden und damit verbunden die Entscheidung, wer eingestellt wird, eine, durch die man sich als Unternehmen – beispielsweise durch ein besonderes Augenmerk auf Diversität – politisch engagieren kann.
In der aktuellen Debatte, wenn wir überlegen, ob und wie Corporate Political Responsibility neu gedacht werden muss, geht es allerdings mehr um öffentlichkeitswirksame Aktionen und Äußerungen, die darauf zielen, einen politischen und gesellschaftlichen Effekt über das einzelne Unternehmen hinaus zu bewirken. Hier beginnt das Engagement meist nicht bei elaborierten politischen Statements, sondern meines Erachtens häufig schon bei dem öffentlichen Bekenntnis zu einem bestimmten Wert – kürzlich etwa in der “Zusammenland”- oder “We stand for Values” -Kampagne, bei denen sich eine Vielzahl von Unternehmen zu gesellschaftlicher Vielfalt und Toleranz bekannten.
(2) Wie ist es aus Ihrer Sicht um die Legitimität des politischen Engagements von Unternehmen bestellt? Was ist angemessen und was nicht?
Valentine Baumert: Die Frage nach der Legitimität des politischen Engagements von Unternehmen hat aus meiner Sicht zwei Seiten: Einerseits geht es offensichtlich darum, wie sehr sich Unternehmen normativ betrachtet überhaupt politisch engagieren sollten. Auf der anderen Seite geht es bei der Frage nach der Legitimität aber auch darum, welches Ausmaß an Engagement aus gesellschaftlicher und politischer Sicht als legitim empfunden wird – was wird an politischem Engagement also aus eher subjektiver Sicht akzeptiert.
Rein normativ sind Unternehmen erstmal einem gewissen Maß an Neutralität verpflichtet. Diese Neutralität wird von ihnen gesellschaftlich erwartet und zeigt sich beispielsweise darin, dass Unternehmen ihre Ressourcen – meist ihre monetären Ressourcen – nicht für eine einzige, klar erkennbare (partei-)politische Agenda einsetzen. Die Neutralität würde man gesellschaftlich vermutlich schon dann als verletzt sehen, wenn ein Unternehmen sehr hohe Summen an nur eine einzige politische Partei spenden würde. Ein Weg, um diese Gefahr zu vermeiden, ist, sich positiv zu grundlegenden Werten und zu der Verfasstheit unseres politischen Systems zu bekennen und ein Bekenntnis zu oder gegen eine Partei zu meiden. Ich persönlich wäre hier der Ansicht, dass man damit nie Gefahr läuft, sich illegitim zu engagieren. Und da ich davon überzeugt bin, dass es aktuell unvermeidbar ist, sich politisch so positionieren, sehe ich in diesem Bekenntnis für etwas, dem Setzen eines positiven Wertes, eine gute Möglichkeit, sich zu engagieren, ohne die politische Neutralität der Wirtschaft zu verletzen.
Die Frage nach der gesellschaftlich empfundenen Legitimität ist etwas schwieriger – hier sehen wir, sofern sich Unternehmen politisch engagieren, häufig noch Vorwürfe, man habe es mit einer reinen PR-Maßnahme zu tun. Die Ernsthaftigkeit des Engagements wird oft noch bezweifelt. Dem können Unternehmen aber nur mit der Dauerhaftigkeit ihres Engagements und dem Beweis, dass es sich nicht um politischen Opportunismus handelt, etwas entgegensetzen.
(3) Welche Grenzen hat politisches Engagement von Unternehmen und wann kann es auch gefährlich und schädlich sein?
Valentine Baumert: Ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wann politisches Engagement von Unternehmen schädlich oder gefährlich werden kann, ist wohl das Ausmaß, in dem Unternehmen ihren Mitarbeitenden vermitteln oder suggerieren, welche Parteien wählbar sind. Besonders im Kontext des Erstarkens rechtspopulistischer Parteien gewinnt dieses Beispiel an Relevanz. Unternehmen laufen hier Gefahr, zu viel Druck auf die politischen Einstellungen ihrer Mitarbeitenden auszuüben. Natürlich kann man als Unternehmen Werte und eine gewisse Unternehmenskultur vermitteln. Dass Mitarbeitende allerdings das Gefühl bekommen, sie würden aufgrund ihrer Wahlentscheidung potenziell Sanktionen ausgesetzt sein, läuft dem zuwider, gegen das man sich eigentlich stark machen möchte. Denn, man muss immer bedenken: Dass der Arbeitgeber Arbeitnehmer nicht aufgrund ihrer politischen Einstellungen benachteiligen darf, soll vor Diskriminierung schützen. Und das gilt nun mal für jede politische Einstellung der Arbeitnehmer.
Das Wichtigste ist allerdings aus meiner Sicht, dass klar bleibt, dass Unternehmen den – systemtheoretisch gesprochen – Zweck, den das politische System in der Gesellschaft erfüllt, weder erfüllen können noch sollen. Die oberste Maxime der Wirtschaft ist eine andere, als die des politischen Systems, das sich idealerweise zu allererst an dem Allgemeinwohl orientieren sollte. Das muss Politik tun, Unternehmen können und werden dies nicht leisten. Wenn diese Trennung nicht klar bleibt und Unternehmen zu stark versuchen, Aufgaben des politischen Systems zu übernehmen, kann das sehr gefährlich sein.
(4) Welche internen Strukturen (Corporate Governance) und welche Expertise benötigen Unternehmen, um gute politische Entscheidungen zu treffen?
Valentine Baumert: Intern kann es aus meiner Sicht definitiv nicht schaden, für eine Pluralität an Meinungen und Weltanschauungen zu sorgen und vor allem auch einen Raum zu schaffen, in denen diese geäußert werden können und respektiert werden. Auch ein kollegiales Miteinander, in dem Konkurrenz nicht an erster Stelle steht, verbessert erfahrungsgemäß den Austausch und schlussendlich die getroffenen Entscheidungen.
Und auch die eigene Kritikfähigkeit von Unternehmen verbessert meines Erachtens immer das Ergebnis von Entscheidungsprozessen: Also, Unternehmensentscheidungen hinterfragen zu können und manchmal auch eingestehen zu können, dass etwas falsch entschieden wurde. Beides fördert Werte unter den Mitarbeitenden, die letztlich auch politisch wichtig sind: Toleranz, Diskursbereitschaft und Solidarität.
(5) Worin sehen Sie Chancen und für welche Themen wünschen Sie sich mehr politisches Engagement von Unternehmen?
Valentine Baumert: Ich glaube an Themenbereichen, in denen mehr politisches Engagement notwendig wäre, mangelt es aktuell nicht. Einzelne Themen möchte ich hier also gar nicht nennen. Eine große Chance hat sich allerdings durch die Dringlichkeit, sich angesichts der vielfältigen Problemlagen überhaupt zu engagieren, ergeben: Gesamtgesellschaftlich, aber auch in der Wirtschaft, sehen wir eine enorme politische Mobilisierung. Besonders im letzten halben Jahr konnte man sehen, dass viele Unternehmen sich angesichts des gesellschaftlichen Rechtsrucks trotz anfänglicher Zurückhaltung dazu entschlossen haben, sich politisch zu äußern oder sich durch Kampagnen zu positionieren. Diese politische Mobilisierung in der Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft, würde ich absolut positiv bewerten. Die Potentiale, die dadurch zu gesellschaftlichem Handeln entstehen, müssen genutzt werden und das Engagement für Werte wie Toleranz und Vielfalt dauerhaft aufrechterhalten und weitergeführt werden.
Über Valentine Baumert

Valentine Baumert studierte Politikwissenschaft und Publizistik an der Freien Universität Berlin. Während ihres Studiums war sie an der Freien Universität als Tutorin tätig. Seit 2020 ist sie als Executive Government Affairs bei der Philip Morris GmbH. Die “Wie wir wirklich leben”-Studie verantwortet sie ebenfalls seit 2020.